Explorative Analyse
Analyse der Ratgebertitelseiten
Der Korpus und das Vorgehen der Analyse
Das Korpus der Ratgebertitelseiten setzt sich aus insgesamt 25 Titelseiten von Schwangerschaftsratgebern zusammen, jedoch wurden zu Beginn die ersten 206 Ergebnisse einer Amazon.de-Büchersuche [17] gespeichert. Der Name der Bilder entspricht hierbei der Position in dieser ursprünglichen Suche vom 28. April 2016. Kriterien der Suche waren der Begriff ‚Schwangerschaft‘ in der Rubrik ‚Ratgeber‘ [18] und die Suchfunktion ‚Beste Ergebnisse‘, die am ehesten das Kauf- und Leseverhalten repräsentiert. Da vor allem im Ratgebersegment der Markt gebrauchter Bücher entscheidend ist, wurden sowohl Neu- als auch Gebrauchtwaren einbezogen [19]. Diese ersten 206 Ergebnisse wurden anschließend nach zentralen Motiven geclustert [20]. Mit 107 Zuweisungen ist die Kategorie Babybauch mehr als dreimal so häufig anzutreffen wie die nächstgrößten Kategorien Baby und Mutter mit Kind. Die beachtliche Dominanz des sichtbaren Schwangerschaftsbauchs sowie der primäre Fokus bezüglich des visuellen Diskurs der Schwangerschaft, und nicht z. B. Mutterschaft, Vaterschaft oder Familie [21], konzentriert den Korpus auf alle Bilder einer bestehenden (bzw. unmittelbar bevorstehenden) Schwangerschaft. Post-Entbindungsbilder wurden hingegen vorerst nicht berücksichtigt. Der Korpus wurde also auf 107 Bilder mit Babybauch begrenzt. Schließlich wurde begonnen, diese Bilder systematisch zu betrachten und alle Auffälligkeiten entsprechend der entwickelten Checkliste in einer Tabelle zu Dokumentieren [22]. Nach 25 durchgeführten Analysen [23] wurde eine Sättigung des analysierten Datenmaterials erreicht, die keine weiteren Erkenntnisse mehr ermöglichte.
Auf eine detaillierte Dokumentation der Codings und verbale Illustration der Analyseergebnisse wird an dieser Stelle verzichtet, da die detaillierte Beschreibung des Datenkorpus für das Interesse dieser Arbeit nicht relevant ist. Diese kann jedoch im Anhang nachgelesen, sowie anhand der beigelegten Analysedateien nachvollzogen werden [24]. Das Ziel dieses Abschnitts liegt in einer Kondensation typischer und markanter Stilelemente, die sich bei einer Vielzahl von visuellen Artikulationen aus dem betrachteten Datenkorpus wiederfinden lassen. Diese wird prägnant skizziert und interpretiert, um schließlich Erkenntnisse bezüglich der Praktiken der Differenzierung und Äquivalenzierung bzw. der Überlappung von diskursiven Momenten abstrahieren zu können.
Bei der Analyse wurde auf folgende Aspekte besonderen Wert gelegt: Wer ist schwanger und welche Eigenschaften und Charakteristiken zeichnen die Schwangeren aus? Mit welchen Aspekten wird Schwangerschaft in Verbindung gebracht? In welchem Umfeld, in welchen sozialen Interaktionen und mit welchen Objekten werden die Schwangeren abgebildet? Welchen Einfluss haben formale Kompositionselemente, wie Perspektive, Bildausschnitt, Einstellung, planimetrische Feldlinien etc. auf den Eindruck, den man von der dargestellten Situation erhält? Was zeichnet die Beziehung zwischen Schwangerer und Ungeborenem aus sowie, welcher Handlungsraum eröffnet sich der Schwangeren? Fallen besondere Farbkonzepte auf und lassen sich diese entsprechend symbolischer Wirkungen interpretieren?
Kernaspekte des Korpus Ratgebertitelseiten
Für den Korpus der Ratgeber lassen sich folgende zentrale Erkenntnisse zusammenfassen: Wenn ein Umfeld auf den Bildern erkennbar ist, so befinden sich die Frauen am häufigsten in einem Wohnzimmer und sitzen dann meist auf einem beigen/hellen Sofa. Öffentliche Räumlichkeiten oder urbane Sphären existieren nicht [25] , ebenfalls sind mit einer Ausnahme keine Männer abgebildet. Diese Aufteilung erinnert stark an die Trennung von Produktions- und Reproduktionsarbeit, bei der Männer verhältnismäßig häufiger in der öffentlichen Sphäre und der Arbeitswelt vertreten sind, während Frauen vermehrt mit Haushalt und Familie beschäftigt sind. Zudem lässt sich daraus schließen, dass die Beobachtung von Bauer (2010: 105ff.), dass Schwangerschaft zur Frauensache gemacht werde, Männer dagegen tendenziell nach der Befruchtung obsolet werden, visuell reproduziert wird.
Analog zum hellen Sofa tragen die Schwangeren in mehr als der Hälfte der Fälle helle, zumeist weiße oder beige und ausgesprochen legere und bequeme Freizeitkleidung. Hierdurch wird zum einen der Eindruck großer Behaglichkeit transportiert. Zum anderen kann man auch in diesem Kleidungsstil eine visuelle Verdopplung der Trennung von (Re-)Produktionsarbeit erkennen, da solch ein Stil weder in einem Arbeitsumfeld und meist noch nicht einmal in einer öffentlichen Sphäre an sich gesellschaftlich akzeptiert wäre. In unserem Kulturkreis steht die dominant verwendete Farbe Weiß für Reinheit und Unschuld, wodurch einerseits die Assoziation zu klinischer Sterilität aktualisiert werden kann. Da Schwangerschaft zunehmend mit medizinischen Kontroll- und Vorsorgemaßnahmen einhergeht, ist eine solche Interpretation naheliegend, auch wenn Schwangerschaft selbst nicht als Krankheit, allenfalls als (sozial) ‚erwünschte Behinderung‘ gelten kann (vgl. Hirschauer et al. 2014: 257). Andererseits gelten historisch-kulturell sowohl die Mutterliebe als die reinste der Form der Liebe, als auch Kinder prinzipiell als unschuldig, ihre Existenz als erstrebenswert. Eine visuelle Kombination der symbolischen Konnotation der Farbe Weiß sowie das Wissen um die Reinheit und Unschuld, die mit der Entstehung von Leben und der Liebe einer Mutter verbunden wird, ermöglicht eine interpretative Vermutung (jedoch keine abschließende Aussage) dessen: So scheint es, dass sich visuell durch die Dominanz der Farbe Weiß, die damit und mit dem Ungeborenen an sich verbundene Reinheit und Unschuld auf die Schwangere überträgt. Möglicherweise bedeutet das, dass eine Frau durch ihre Schwangerschaft eine Art kartesische Reinigung durchläuft und hierdurch zu ihrer reinsten und natürlichsten Form als Mutter gelangt [26]. Ebenso lassen die Bilder Assoziationen mit typischen Bildern aus dem Kontext der Yoga-Philosophie zu, welche die Auslegung von Ausgeglichenheit, Resilienz nahelegt. Hierdurch scheinen die Schwangeren völlig in ihrem Element zu sein.
Passend zur Freizeitkleidung sind die Schwangeren nur dezent geschminkt und tragen die Haare locker gebunden oder offen. Alle Frauen sind sportlich-fit, gesund, zwischen 25 und 35, mitteleuropäischen Hauttyps und gehören vermutlich einer oberen sozialen Schicht an [27]. Sozial – wenn auch nicht medizinisch – gesehen, ist dies das ideale Alter einer Schwangerschaft: Risiken medizinischer Komplikationen sind zwar in diesem Alter schon ansteigend, jedoch beginnen klassische Risikoschwangerschaften erst bei etwas älteren Frauen. Der Berufseinstieg ist in dieser Altersspanne jedoch zumeist abgeschlossen, wodurch ökonomische Sicherheit und eine gute materielle Versorgung des Kindes wahrscheinlicher, der Sozialstaat demnach weniger belastet ist. Der solide soziale Hintergrund und die Abwesenheit eines, häufig mit einem schwächeren sozialen Status einhergehenden, offensichtlichen Migrationshintergrunds der Schwangeren verstärkt die Hypothese, dass es sich hierbei nicht um eine durchschnittliche, sondern die als ideal konstruierte Schwangere handelt.
Obwohl (fast) alle Frauen sehr offensichtlich schwanger, also im letzten Trimester oder gar im letzten Monat sind, haben sie dennoch keine optischen Makel, d. h. weder Dehnungsstreifen, Narben (z. B. von vorherigen Kaiserschnitten), Hautunreinheiten oder zeigen andere Stresssymptome, wie dies Augenringe, schwitzige Haut etc. sein könnten. Ein zufriedenes Lächeln unterstreicht stets den harmonischen Eindruck. Die visuell fortgeschrittene Schwangerschaft bedeutet jedoch auch, dass Zeiten der Vorbereitung, der Empfängnis, der Einnistung des Fötus und die zahlreichen damit verbundenen möglichen Komplikationen und Risiken visuell nicht existent sind, obwohl diese den Großteil des Beratungsgegenstandes in den Ratgebern selbst darstellen (vgl. Bauer 2010).
Schaut die Schwangere direkt in die Kamera, so entsteht bei dem*der Betrachtenden der Eindruck eines Blickkontakts zur Schwangeren. In genau gleich vielen Fällen wird jedoch durch den Zuschnitt des Bildes das Gesicht der Schwangeren weggeschnitten. Folglich kann weder Blickkontakt suggeriert noch eine Blickrichtung identifiziert werden. Die Schwangere als Person, erscheint hierdurch von nebensächlicher Relevanz zu sein. Kontakt und Nähe mit dem Ungeborenen wird in deutlich mehr als der Hälfte der Fälle haptisch mit der Hand am Babybauch und/oder visuell durch die Entblößung dessen erzeugt. Ohne die trennende Wirkung der Kleidung kann gleichermaßen der*die Betrachter*in visuell, die Schwangere jedoch zusätzlich auch haptisch, einen unmittelbareren und damit intensiveren Kontakt mit dem Ungeborenen aufbauen. Der Fokus der*des Betrachters*in auf den Babybauch wird vor allem mithilfe einer auf den Schwangerschaftsbauch erniedrigten Normalsicht, einer Blicklenkung anhand von Feldlinien und/oder einer zentralen Positionierung des Bauches im Bildausschnitt gesteuert. Hierdurch scheint die Schwangere nur eine Nebendarstellerin der Komposition zu sein.
Darüber hinaus wird in weitaus mehr als der Hälfte der Fälle die Schwangere entsprechend der hier üblichen Leserichtung ausgerichtet und/oder auf der linken Bildhälfte platziert. Kompositorisch erzeugt dies jedoch in den seltensten Fällen eine rein positive, progressive Wirkung, wie dies bei einer solchen Komposition in anderen Kontexten sonst üblich ist [28]. Weitaus häufiger verbleibt, den Feldlinien geschuldet, eine (er-)drückende bzw. hängende Wirkung und/oder der Eindruck einer Kippbewegung, in der die Frau meist in Leserichtung mitgerissen scheint, jedoch nicht stabil und souverän vorangeht. Zumeist wird zusätzlich diese Souveränität und ihre Handlungsmöglichkeiten durch einen sehr engen Bildzuschnitt und/oder ihre immobile Körperhaltung eingeschränkt, während ihre Aufmerksamkeit zugleich nur dem eigenen Körper, bzw. des darin befindlichen Ungeborenen, gilt. Die Umgebung und die (in dieser implizierten) nähere Zukunft der Schwangeren ist somit weder für sie noch für die Betrachtenden erfassbar. Die visuell-kompositorisch implizierte Zukunftsorientierung scheint hierdurch ausschließlich dem Ungeborenen zu gelten, während die Schwangere selbst keine nennens- oder beachtenswerte Zukunft hat. Hierdurch beschränkt sich auch das Maß ihrer sozialen Interaktion lediglich auf das Ungeborene, als körperliche Einheit aus der Schwangeren und dem Ungeborenem sind sie sozial isoliert. Auch Väter, Freund*innen oder ähnliches sind im Korpus so gut wie nicht existent und verstärken dadurch den Eindruck einer sozialen Isolation.
Während durchaus ein Spektrum an Variationen beobachtbar ist, so scheint jedoch keines der Titelbilder zu einer von den obigen Verallgemeinerungen abweichenden Bildinterpretation zu führen. Keine bietet demnach eine gegenläufige Interpretation dessen an, was es heißt, schwanger zu sein. Keine der betrachteten Artikulationen scheint den obigen Verallgemeinerungen grundsätzlich zu widersprechen und hierdurch eine gegenläufige Interpretation dessen, was es heißt schwanger zu sein, anzubieten. Diese Konsistenz lässt für das vorliegende Korpus die Schlussfolgerung zu, dass – visuell gesehen – Schwangerschaft nichts Anderes bedeutet, als dass Frauen sich voll und ganz auf die Schwangerschaft und die Veränderungen in ihrem Körper einlassen, sich in die häusliche und damit sozial isoliertere Sphäre zurückziehen und zufrieden mit ihrem neuen, selbstverständlichen und natürlichen Aufgabenfeld sind. Kritische Aspekte der Schwangerschaft existieren visuell gesehen nicht, weder medizinische Komplikationen noch körperliche Beschwerden, wie die der möglichen morgendlichen Übelkeit, Rückenschmerzen und Blasenschwäche, werden ausgeblendet.
Illustration der Ergebnisse anhand von Beispielbildern
Zur Illustration der Kernaspekte wurden zwei in gewisser Weise typische Fotografien aus dem Korpus ausgewählt. Das erste Bild (#3) wurde deshalb ausgewählt, da es die meisten der häufigsten Typen in sich vereint, mit Bruell gesprochen, veranschaulicht es die wichtigsten äquivalenzierenden Aspekte und weist den höchsten Grad der Simultanz auf (vgl. Abbildung 1). Das zweite Bild (#18) hingegen fällt in mancher Hinsicht etwas aus der Reihe, illustriert aber ebenfalls ein Bild mit vielen typischen Ausprägungen und stellt einen Kontrapunkt zu Bild #3 dar (vgl. Abbildung 3). Anhand dieser beiden Bilder lassen sich zwei verschiedene, sich überschneidende Abschnitte der gleichen Äquivalenzkette veranschaulichen und geben dadurch einen besseren Eindruck von der gesamten Äquivalenzkette. Bild #3 versammelt exemplarisch folgende Aspekte: Der für die Auswahl markanteste Aspekt war die Vereinigung der drei häufigsten kompositorischen Effekte einer drückenden, progressiven Kippwirkung (vgl. Abbildung 2). Die Schwangere fällt förmlich in Leserichtung auf das Sofa und ihre Körperhaltung neigt sich vom linken zum rechten Bildraum, gleichzeitig scheint die obere Bildhälfte die Schwangere in Richtung der unteren Bildhälfte, in das Sofa, zu drücken. Die Kippbewegung erscheint hierdurch noch stärker, da sie optisch dem Druck durch die diagonale Körperhaltung nachgibt. Zusätzlich befindet sich die Frau sitzend, in beiger, bequemer Kleidung auf einem beigen Sofa in einer offensichtlich häuslichen Sphäre. Auch Make-up und Frisur sind locker und dezent und unterstreichen die Informalität des Settings. Ihr Babybauch ist entblößt, sie baut sowohl mit Händen, als auch mit dem Blick Kontakt zu ihrem Ungeborenen auf, der kompositorisch im Mittelpunkt des Bildes und durch den Bezugspunkt der Normalsicht zum elementaren Narrativ des Bildes wird. Die Blickrichtung und Körperhaltung der Schwangeren beschränken ihren Handlungsspielraum maßgeblich auf das Ungeborene, andere Objekte, Interessen oder soziale Interaktionen scheinen außer Reichweite zu sein.
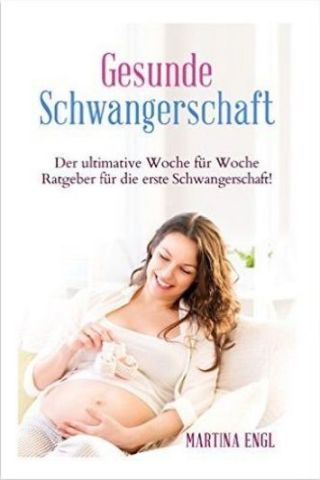 |
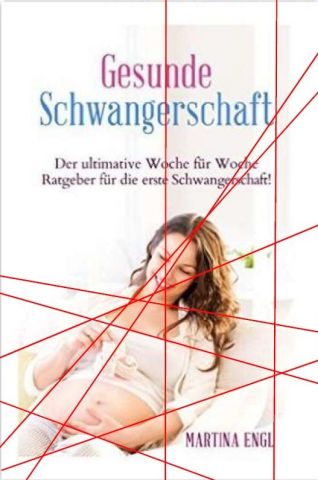 |
| Abbildung 1: Titelbild #3 | Abbildung 2: Titelbild #3 mit Feldlinien |
Da das Bild #3 den typischsten, jedoch nicht alleinig bemerkenswerten Bildausschnitt der Halbnahen aufweist, war für die Auswahl des zweiten beispielhaften Bildes (#18) unter anderem der Bildausschnitt der Großaufnahme besonders relevant. Durch den Bildausschnitt und die im Folgenden illustrierte Komposition des Bildes scheint die abgebildete Schwangere selbst kaum Handlungsspielraum zugeschrieben zu bekommen: Die Abwesenheit ihres Gesichts verhindert das Zentrum ihrer Aufmerksamkeit ausfindig zu machen, der fehlende Freiraum macht etwaige Handlungsmöglichkeiten unsichtbar. Außerdem ist sie in einer immobilen Körperhaltung gefangen, da sie auf den eigenen Fersen sitzt, sich dadurch nicht einfach fortzubewegen vermag. Auch ihre Hände sind am unteren Bildrand, den Schwangerschaftsbauch rahmend, aufgrund der Bildunschärfe nur zu erahnen. Mögliche Anschlusshandlungen werden dadurch allein optisch ausgeblendet. Während sich die Gesamtkomposition des Bildes durch eine besonders progressive Wirkung auszeichnet (vgl. Abbildung 4) – das Kleinkind scheint mit seiner Handlungsmacht, seinen Armen, seinen Blicken geradezu auf den Bauch der Schwangeren zuzuströmen – ist die Position der Schwangeren selbst statisch. Außerdem ist die Schwangere entgegen der Leserichtung ausgerichtet, sie selbst ist beschränkt auf den rechten Bildraum, das Handlungspotential des Kindes scheint sie von oben links auf die eigenen Knie bzw. den Fersensitz zurückzudrängen. Durch die besonders starke Ausstattung des Kindes mit Handlungspotentialen, wirkt die Schwangere ungemein passiv. Sie kann lediglich versuchen, die Progression des Kindes aufzufangen, ihr jedoch nicht ausweichen oder selbst proaktiv werden. Dies wird in Kombination mit dem Bildausschnitt noch verstärkt, der nur noch die Brüste und den Bauch der Schwangeren erkennen lässt. Ohne Gesicht wirkt die Schwangere vollständig entsubjektiviert und nur noch als Körper anwesend. Ein weiteres kontrastierendes Element des Bildes ist ein anderes, wenn auch bedeutend seltener vorkommendes Setting, als das der häuslichen Sphäre, denn es ist auf einer Blumenwiese aufgenommen. Diese Kombination von Natur und Schwangerschaft bzw. Mutterschaft legt eine Lesart nahe, die impliziert, dass es in der Natur der Schwangeren liege, für das Ungeborene und das Kleinkind zu sorgen, es ‚aufzufangen‘.
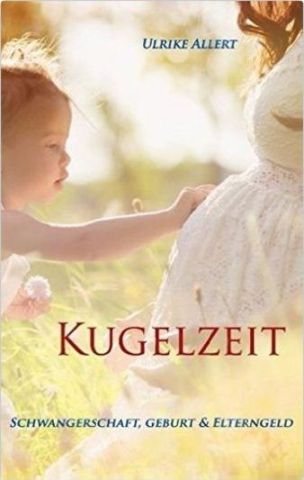 |
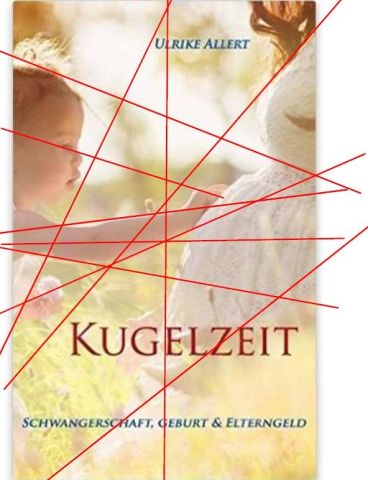 |
| Abbildung 3: Titelbild #18 | Abbildung 4: Titelbild #18 mit Feldlinien |
Jedoch scheint dieses Bild aufgrund von zwei Aspekten eher eine bemerkenswerte Ausnahme im Datenkorpus darzustellen, denn so ist es das einzige Bild, in dem eine Schwangere und ein Kleinkind zugleich dargestellt sind [29]. Es ist somit das einzige Bild, das die Interpretation der abgebildeten Schwangeren als Erstgebärende erschwert. Außerdem entspricht das von der Schwangeren getragene Kleid nicht dem legeren Freizeitlook, den die restlichen Frauen zu tragen pflegen. Stattdessen führen die zahlreichen Spitzen des Kleides zu einer Romantisierung des Dargestellten. Dies wird durch die zarten Farben des Umfeldes und die künstlich erzeugte Bildunschärfe noch zusätzlich verstärkt. Das weiße Spitzenkleid legt zudem Assoziationen zu einem Brautkleid nahe [30].
Schlussfolgerungen und Implikationen der analysierten Aspekte
Mithilfe des hier vorgeschlagenen Instrumentariums – kondensiert aus den methodischen Überlegungen von Meier, Nonhoff und Bruell – lassen sich, wie eben illustriert, auch größere Korpora bestehend aus Bildern und Fotografien behandeln, analysieren und interpretieren. Spannende und unerwartete Erkenntnisse ließen sich hiermit durchaus produzieren. Mittels unterschiedlicher Stilmittel, Äquivalenzierungen und Beziehungen zu anderen Aspekten konnte nachvollzogen werden, wie Schwangerschaft als zunächst überpositiv dargestellt wird. Als natürlich konstruierter Prozess wird Schwangerschaft hierdurch ausschließlich erstrebenswert und schließlich begehrenswert. Die essentielle Bedeutung von Schwangerschaft für die soziale Ordnung wird damit visuell bestätigt. Dass Schwangerschaft dennoch auch anders aussehen und gelebt werden könnte, einen anderen Stellenwert in der Biographie der Subjekte einnehmen könnte und vor allem, dass Schwangerschaft nicht notwendigerweise die einzige und universale Lösung für den Erhalt der Gesellschaft ist, wird hierdurch ausgeblendet und tendenziell unsichtbar.
Während sich durchaus Variationen in der konkreten Darstellung der Schwangerschaft zeigen, – nicht alle Kompositionen sind eine Kombination der identischen Stilmittel – so sind gegenläufige und widersprüchliche Interpretationen dessen, was unter Schwangerschaft zu verstehen ist, in welchem Körper eine Schwangerschaft stattfinden soll und in welchem besser nicht, und in wie weit sich der Alltag und das Umfeld der Schwangeren auf die neuen Umstände anzupassen haben, nicht mit dem vorliegenden Datenkorpus möglich. Zumindest im Bereich der Ratgebertitelseiten fällt eine beachtliche Konsistenz dessen auf, was Schwangerschaft bedeutet. Die starke Konsistenz der Fotografien bezüglich ihres Interpretationsspektrums ist bemerkenswert und führt zu dem Schluss, dass es sich keineswegs um eine Ansammlung verschiedener, gleichfalls möglicher Artikulationen handelt. Stattdessen scheint es sich stets um eine beständige Reproduktion der immer gleichen Artikulation zu handeln. Der Grad der sozialen Isolation, der Verweis auf die häusliche Sphäre der Reproduktionsarbeit, der Ausschluss aus einem öffentlichen Alltag, dem Berufsleben sowie aus sozialen Netzwerken ist innerhalb des Korpus beachtlich. Die Homogenität der Frauen, die schwanger sind, ist ebenfalls bemerkenswert, da es sich hierbei um die Bevölkerungsgruppe handelt, die tendenziell, im gesamtgesellschaftlichen und globalen Vergleich, geringe Geburtenraten aufweist. Eine weiße Hautfarbe, die auf eine typischerweise mitteleuropäische Herkunft schließen lässt, ein solider sozialer und ökonomischer Status, im sozial-idealen Alter, mit ausgezeichneter körperlicher Fitness und Gesundheit und schließlich auch noch dem gängigen Schönheitsideal entsprechend, scheinen hierdurch visuell als Anforderungen für eine erstrebenswerte Schwangerschaft in Stellung gebracht werden.
In der Tat könnte sich die beachtliche Homogenität des Korpus bezüglich der Ethnizität der Schwangeren dadurch erklären, dass die Selbstwahrnehmung der deutschen Bevölkerung einer weißen Ethnizität entspricht, während der Aspekt ihrer Multikulturalität als Einwanderungsgesellschaft verdrängt und aus marketingtechnischen Gründen einvernehmlich ignoriert wird. Letzten Endes sind Fragen nach solchen möglichen Motiven und Intentionen diskurstheoretisch nebensächlich. Als Anordnungen von ‚Dingen‘ und ‚Fakten‘ erzeugen Diskurse Bedeutungen, die zu Formationen von gültigem Wissen gruppiert werden können. „Diese Formationen scheiden das Wahre vom Falschen, das Normale vom Abartigen oder Außergewöhnlichen usw.“ (Nonhoff 2004: 73). Beziehen sich Diskurse auf den Menschen oder sein Verhalten, so wird dieser mit normalisierender und disziplinierender Macht konfrontiert. Diese Macht ist keineswegs repressiv, sondern produktiv, da mittels Diskursen einerseits wahres Wissen und andererseits Subjekte produziert werden (vgl. 73ff.). Statt nach Intentionen oder Motiven zu suchen, stehen stattdessen die diskursive Konstruktion von sozialer Ordnung und die machtabhängigen Subjektpositionen, die sich hieraus ergeben, im Vordergrund.
Während keine der Fotografien die positive Bewertung auch davon abweichender Schwangerschaft in Frage stellt, – natürlich werden keine Schwangerschaftsverbote für andere Demographien explizit ausgesprochen – so muss die Homogenität des Korpus bezüglich der Bedeutung des Unsichtbaren, des nicht-Artikulierten befragt werden. Welche Konsequenzen folgen daraus, dass Abbildungen anderer Schwangerer abwesend bleiben? Und welche Rückschlüsse lassen sich aus dem nicht-Artikulierten für die Konstruktion der Äquivalenzkette des Mangels ‚Q‘ ziehen?
Die diskursive Verhandlung von Schwangerschaft legt nahe, dass die Geburt von Kindern generell als positiv und erstrebenswert bewertet wird, denn sie sichert den Fortbestand der sozialen Ordnung. Eine rückläufige Geburtenrate stellt eine Gesellschaft vor Herausforderungen, die ihre Stabilität gefährden. So stellt zum Beispiel in Deutschland – entsprechend des Vorbildes eines Generationenvertrags – die Produktivkraft jüngerer Generationen die Versorgung der Generationen im Ruhestand sicher. Eine alternde Gesellschaft stört jedoch ein solches Gleichgewicht und kann jüngere Generationen an ihre Belastungsgrenzen bringen. Salopp gesagt ist ein Nachwuchs an Steuerzahlenden gesellschaftlich erstrebenswert. Eine rückläufige Geburtenrate könnte somit als Mangel interpretiert werden, der diskursiv verhandelt wird.
Jedoch wird in den hier betrachteten Artikulationen scheinbar nicht eine rückläufige Geburtenrate an sich, sondern die einer ganz spezifischen sozialen Gruppe verhandelt. Die Unsichtbarkeit anderer Schwangerer legt nahe, dass diese Formen der Schwangerschaft nicht den Mangel in seiner Gänze zu überwinden versprechen. Rückläufige Geburtenraten sind außerdem kein globales Problem, – im Gegenteil, die Weltbevölkerung steigt rasant – sondern eines westlicher Industrienationen. Hierdurch zeigt sich, dass der diskursiv verhandelte Mangel nicht der bedrohte Fortbestand der Menschheit überhaupt ist, sondern sich auf eine westliche, wenn nicht sogar nur der deutschen Gesellschaft, bezieht. Andernfalls wären zwei umfassende Forderungen denkbar, die beanspruchen könnten, den Mangel zu beheben: Sowohl Babies anderer sozialer Gruppen als auch verstärkte Migration aus geburtenreichen Ländern könnten die demographische Entwicklung ausgleichen. Jedoch scheinen dies keine legitimen Forderungen zu sein, sie treten im Korpus nicht auf. Dementsprechende Darstellungen sind folglich vermutlich unsagbar und damit auch undenkbar. Mit dem Diskurs der Migration verknüpfte Narrative der Überfremdung, fehlender sozialer Integration, eines antizipierten Wertverlusts sowie die Befürchtung von steigender Kriminalität und sozialen Konflikten, verhindern, dass eine solche Forderung zu einer umfassenden und damit legitimen Forderung werden könnte. Dies lässt den Schluss zu, dass der diskursiv verhandelte grundlegende Mangel nicht der Mangel an Steuerzahlenden ist, zumal für einen Generationenvertrag die Ethnizität eines*r Steuerzahlers*in von nachgelagerter Bedeutung ist. Stattdessen scheinen nur weiße Babys aus einem soliden sozialen Hintergrund den Mangel der alternden, westlichen Gesellschaft in seiner Gänze zu überwinden zu versprechen und den Fortbestand des Abendlandes zu sichern.
Das sind starke Forderungen, die in dieser sprachlichen Illustration durchaus Unbehagen auslösen. Während zu Beginn der Betrachtung scheinbar eine Sammlung an positiv konnotierten Artikulationen zum Thema Schwangerschaft erfahrbar war, so wird mithilfe dieser Ausführungen ein biopolitisches Ausmaß der Bilder bewusst, das nicht nur bedenklich, sondern rassistisch und diskriminierend ist. Während man sprachlich lediglich von einer Schwangeren reden kann, so lassen sich die eben illustrierten Aspekte visuell gesehen nicht von einer solch neutralen Formulierung isolieren, sie müssen stets mitgedacht werden. Formuliert man folglich das Dargestellte als sprachlichen Text aus, und verallgemeinert dies entsprechend der Häufigkeiten der visuellen Artikulationen, so wirkt dieser Text zumindest verstörend, wenn nicht sogar empörend. Bei den visuellen Artikulationen an sich ist jedoch nichts Empörendes zu finden, wodurch ein Bedürfnis einer sprachlichen Relativierung erst nach der Verbalisierung auftritt. Zugleich werden scheinbar die visuellen Artikulationen als Repräsentation der Wirklichkeit unkommentiert und vor allem unrelativiert hingenommen [31]. Genau diesem Umstand soll in den folgenden Abschnitten besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden.
nach oben | direkt weiter zu den Ergebnissen der Ratgeberanalyse
[17] Durch den großen Marktanteil und die rege Nutzung eignet sich ‚Amazon.de’ besonders als Feldzugang zum deutschen Buchmarkt. Die Plattform bietet eine einmalige Fülle an Produkten und ermöglicht darüber hinaus durch seinen Algorithmus der Suchoption ‚Beste Ergebnisse‘ Nutzerverhalten und die zugeschriebene Relevanz der Produkte in das Korpus einfließen zu lassen.
[18] Die Rubrik wurde hierfür (zum Teil automatisch von ‚Amazon.de‘) auf folgende Weise eingeengt: Bücher > Ratgeber > Gesundheit & Medizin > Frauen > Schwangerschaft
[19] Der abgedeckte Markt beschränkt sich vor allem auf den deutschsprachigen Buchmarkt. Selbstverständlich ist davon auszugehen, dass in anderen Ländern, anders über Schwangerschaft ‚geredet‘ wird, andere Bilder damit verknüpft werden und andere Normen reproduziert werden. Jedoch ist das Ziel dieser Arbeit nicht, das Bild der Schwangerschaft in seiner Gesamtheit zu erfassen, sondern Techniken der Analyse von visuellen Regelmäßigkeiten zu erproben und entsprechend erster Erkenntnisse Weiterentwicklungspotentiale aufzuzeigen.
[20] Die Kategorien der Gruppierung sind in alphabetischer Reihenfolge (Doppelzuordnungen möglich): Baby (37, davon 12 in Uterus), Babybauch (107), Babysachen (13), Ernährung (21), Grafik/nur Text (26), Medizinobjekte (4), Mutter mit Kind (30), nicht zuordenbar (10), Paar (15), Sport (19), Vater mit Kind (8)
[21] Nicht alle Cluster legen den Diskurs Schwangerschaft als zentralen Bezugspunkt nahe, angrenzende Diskurse scheinen im Vordergrund zu stehen, so z.B. Mutterschaft, Vaterschaft, Familienplanung oder Erziehung.
[22] Das Layout, der Titel und die generelle grafische Aufmachung sind wichtige Aspekte eines Covers, werden jedoch vorerst nicht berücksichtig.
[23] Das zuletzt analysierte Bild besaß die Position 51 in der ursprünglichen Suchanfrage. Suchergebnisse mit nur schlechter Bildqualität als auch Suchergebnisse, die trotz der vorherigen Einstellungen nicht zum Segment gehören, wurden bei der Analyse übersprungen.
[24] Das Vorgehen der Analyse war hierbei dadurch gekennzeichnet, dass die eingangs skizzierten Merkmale in einer Excel-Tabelle aufgelistet und anhand dieser die einzelnen Bilder betrachtet, beschrieben und schließlich einheitlich kodiert wurden. Zur Kodierung wurde die Software ‚MAXQDA‘ verwendet. Diese Kodierungen dienten weniger einer repräsentativen Interpretation des Diskurses Schwangerschaft oder einer Ermittlung exakter Korrelationen. Vielmehr sollten sie eine intersubjektive Nachvollziehbarkeit und Systematisierung des Datenkorpus ermöglichen. Die Beobachtungen wurden schließlich in einen zusammenhängenden Text übersetzt, der im Anhang zur Verfügung steht, und anschließend entsprechend der hier verfolgten Interessen zusätzlich kondensiert.
[25] Denkbar wären Einkaufszentren, Arztpraxen, Büroräumlichkeiten, öffentliche Plätze, Parkanlagen etc.
[26] Ähnliches beobachtet auch Bauer für Ratgeber allgemein: „Man kann sagen, dass die Frau, biologisch betrachtet, durch die Schwangerschaft endlich denjenigen Körper bekommt, den sie schon immer haben sollte. Durch die Schwangerschaft wird sie so gesehen erst richtig zur Frau, denn sie erfüllt als Gattungswesen, als spezifisches Reproduktionselement, ihren Zweck“ (Bauer 2010: 44).
[27] Diese Kategorie ist nur mittels Indizien erfassbar. Die Theorie des Habitus legt nahe, dass Geschmäcker zwar verschieden, jedoch sozial geprägt sind. Das sichtbare Schönheitshandeln (Wertigkeit der Kleidung, Stil des Make-Ups, der Maniküre, sowie des Haarstylings) als auch das Umfeld der Schwangeren (Wertigkeit des Sofas, Größe der suggerierten Wohnfläche, Einrichtungsstil, etc.) wurden somit in einer groben Tendenz bezüglich des sozialen Hintergrunds der Schwangeren kodiert.
[28] Eine Zukunftsorientierung wäre beim Thema Schwangerschaft durchaus leicht nachvollziehbar, da es die Zeit der Erwartung, der Vorbereitung und der irreversiblen Veränderungen ist.
[29] Nur ein weiteres Mal existiert ein Kind in den Artikulationen, jedoch nicht das Kind der Schwangeren, sondern einer mit dem Telefon verbundenen Freundin (#17).
[30] Die Verwendung von Spitze romantisiert das vollständig weiße Kleid enorm. In einem westlichen Kulturraum werden dadurch Assoziationen mit einem Brautkleid aktualisiert, dessen weiße Farbe auf ein Narrativ der jungfräulichen Unbeflecktheit verweist. Bei einer bestehenden Schwangerschaft ist dies irrsinnig, jedoch zeigen sich hierbei Parallelen zu Dorothea Bauers Analyse von Schwangerschaftsratgebern. Sie identifiziert, dass der Körper der Schwangeren mit voranschreitender Schwangerschaft eine Entsexualisierung durchläuft (vgl. Bauer 2010: 34).
[31] Bei dieser Beobachtung handelt es sich nicht etwa um das Ergebnis einer Gruppendiskussion, jedoch zeigten einzelne Vorführungen des Datenmaterials im näheren Umfeld kein solches Irritationspotential. Die Darstellungsweise von Schwangeren wurde weitestgehend akzeptiert, denn ‚Schwangerschaft sehe nun mal so oder so ähnlich aus‘. Anstoß wurde lediglich gegenüber der suggerierten Ausgeglichenheit, der (inneren) Ruhe und der Harmonie des Dargestellten genommen, es als unrealistisch bemängelt. Die eben illustrierten biopolitischen Aspekte blieben hingegen vollständig unreflektiert und folglich auch unkommentiert. Dieses Indiz soll ausreichen um einem, mit visuellen Artikulationen verbundenen, ausbleibenden Relativierungsbedürfnis nachzuspüren.
